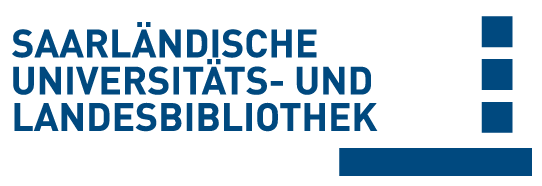Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-45697 | Titel: | Modulating fear processes: Exploring the effects of intranasal insulin, glucose, and COVID-19 anxiety in classical fear conditioning |
| VerfasserIn: | Hauck, Alexander |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| DDC-Sachgruppe: | 150 Psychologie |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Abstract: | Anxiety disorders are among the most common mental illnesses world-wide and are of considerable public health importance due to their high prevalence (Wittchen et al., 2011). Despite the availability of effective treatments for anxiety disorders, millions of people suffer from symptoms that interfere with their daily lives, resulting in persistent distress and reduced overall quality of life (Craske et al., 2009). Within cognitive behavioral therapy, exposure therapy has been shown to be a successful treatment option for many anxiety disorders. Exposure involves systematically exposing patients to anxiety-provoking stimuli in a controlled and safe environment until the fear response diminishes. Despite its high efficacy, not all anxiety patients benefit equally from the therapy, and there are always dropouts, incomplete recovery, or relapse of symptoms (Arch & Craske, 2009). The development and treatment of anxiety disorders can be explained in part by processes of classical conditioning, in which neutral stimuli are given negative meanings through association learning (Duits et al., 2015). Classical models of fear conditioning help to understand the development, maintenance and treatment of anxiety disorders. At the same time, environmental factors, such as traumatic experiences or stressful life events, can play a central role in the development and progression of anxiety disorders. Stress can dysregulate neurobiological systems, particularly the limbic system and the amygdala, and thus increase vulnerability to the development of anxiety disorders (Garakani et al., 2006). Recent global events, such as the COVID-19 pandemic and other crises, may exacerbate these processes through chronic stress, leading to a further increase in the prevalence of anxiety disorders (Kazmi et al., 2020). It is essential to find ways to improve the treatment options for anxiety disorders, in particular to further improve exposure therapy. In addition to the use of classical psychotropic drugs, which are administered in addition to exposure therapy, the use of so-called cognitive enhancers, i.e. substances that influence neurocognitive processes such as attention, memory and learning, is proving to be promising. Studies have identified several such substances that have already shown positive effects in the context of fear extinction, including hormones such as oxytocin or cortisol (Brueckner et al., 2019; de Quervain et al., 2009; Eckstein et al., 2015, 2019). The aim of the present dissertation is to investigate the role of environmental stress and cognitive enhancers as modulating factors of fear conditioning processes. Several aims were pursued and a total of three empirical studies were conducted. The first study aimed to investigate the potential of intranasally administered insulin as a cognitive enhancer in the extinction of fear. To this end, a classical fear conditioning study was conducted with healthy subjects. Before extinction, the subjects were administered either insulin or a placebo by nasal spray. Subjects in the insulin group showed a greater reduction in the fear response during extinction, a first indication of the beneficial effect of intranasal insulin as a cognitive enhancer of fear extinction. The second study investigated the impact of anxiety related to the COVID-19 pandemic on fear learning and fear generalization. The aim was to investigate whether increased anxiety during COVID-19 can lead to increased conditionability and generalization of fear. To this end, a classical fear conditioning study was conducted with healthy subjects and COVID-19-related anxiety was measured. Subjects with higher COVID-19-related anxiety tended to discriminate poorly between safe and dangerous stimuli during fear learning and to generalize their fear response more strongly. Based on the results of the first study, the third study investigated whether the administration of glucose as a cognitive enhancer could improve the effects of fear extinction. Two fear conditioning studies were conducted in healthy subjects, in which the subjects were given either glucose or a placebo before (Study 1) or after (Study 2) extinction. Subjects in the glucose group showed a greater reduction in fear during extinction (Study 1) and during a later recall (Study 2), providing preliminary evidence for the efficacy of glucose as a cognitive enhancer in fear extinction. In conclusion, the three studies presented in this dissertation provide important insights for current research on fear extinction processes and their possible enhancement by cognitive enhancers such as insulin or glucose. Furthermore, the importance of environmental stressors in the development and maintenance of anxiety disorders is highlighted by the demonstrated influence of COVID-19-related anxiety on important fear learning processes such as fear generalization. By integrating the knowledge gained, the studies contribute to a better understanding of fear learning processes and lay the foundation for further research to gain practical implications for improving exposure therapy. Angststörungen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit und haben aufgrund der hohen Prävalenz eine erhebliche Bedeutung für die öffentliche Gesundheit (Wittchen et al., 2011). Obwohl es eine effektive Therapie gegen Angststörungen gibt, leiden Millionen von Menschen unter Symptomen, die das alltägliche Leben erschweren und so zu einer anhaltenden Belastung und Verringerung der allgemeinen Lebensqualität führen (Craske et al., 2009). In der kognitiven Verhaltenstherapie hat sich die Expositionstherapie als bewährte Therapieoption zur erfolgreichen Behandlung vieler Angststörungen erwiesen. Während der Exposition werden die PatientInnen systematisch mit den angstauslösenden Reizen in einer kontrollierten und sicheren Umgebung konfrontiert, bis die Angstreaktion abnimmt. Trotz hoher Effektivität, profitieren nicht alle AngstpatientInnen gleichermaßen von der Therapie und es kommt immer wieder zu Therapieabbrüchen, einer unvollständigen Genesung oder einem Rezidiv der Symptomatik (Arch & Craske, 2009). Die Entstehung und Behandlung von Angststörungen kann unter anderem durch Prozesse klassischer Konditionierung erklärt werden, bei denen neutralen Reizen durch Assoziationslernen eine negative Bedeutung zugeschrieben wird. Klassische Angstkonditionierungsmodelle helfen die Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung von Angststörungen zu verstehen. Gleichzeitig können Umweltfaktoren, wie traumatische Erlebnisse oder stressige Lebensereignisse eine zentrale Rolle bei der Entstehung und dem Verlauf von Angststörungen spielen. Stress kann neurobiologische Systeme, insbesondere das limbische System und die Amygdala dysregulieren und so die Anfälligkeit für die Entwicklung von Angststörungen erhöhen (Garakani et al., 2006). Aktuelle globale Ereignisse, wie die COVID-19 Pandemie und andere Krisen können diese Prozesse durch chronischen Stress verschärfen, und so zu einer weiter steigenden Prävalenz von Angststörungen führen (Kazmi et al., 2020). Es ist von zentraler Bedeutung Wege zu Verbesserung von Therapieoptionen für Angststörungen, insbesondere zur weiteren Verbesserung der Expositionstherapie, zu finden. Neben dem Einsatz von zusätzlich zur Expositionstherapie verabreichten klassischen Psychopharmaka, erweist sich die Verwendung von so-genannten kognitiven Verstärkern, also Substanzen, welche neurokognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Lernen beeinflussen, als vielversprechend. Studien haben mehrere solcher Substanzen identifiziert, welche bereits im Kontext der Angstextinktion positive Effekte zeigten, darunter Hormone wie Oxytocin oder Cortisol (Brueckner et al., 2019; de Quervain et al., 2009; Eckstein et al., 2015, 2019). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Rolle von Umweltstress und kognitiven Verstärkern als modulierende Faktoren von Angstkonditionierungsprozessen zu untersuchen. Dabei wurden mehrere Ziele verfolgt und insgesamt drei empirische Studien durchgeführt. Ziel der ersten Studie war es das Potential von intra-nasal verabreichtem Insulin als kognitiver Verstärker bei der Extinktion von Angst zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde eine klassische Angstkonditionierungsstudie mit gesunden ProbandInnen durchgeführt. Vor der Extinktion wurde den ProbandInnen entweder Insulin oder ein Placebo per Nasenspray verbreicht. ProbandInnen der Insulingruppe zeigten eine stärkere Abnahme der Angstreaktion während der Extinktion, was einen ersten Hinweis für die förderliche Wirkung von intranasalem Insulin als kognitiver Verstärker der Angstextinktion darstellt. In der zweiten Studie wurde untersucht, wie sich auf die COVID-19 Pandemie bezogene Ängste auf das Angstlernen und die Angstgeneralisierung aus-wirken. Ziel war es zu untersuchen, ob eine erhöhte Ängstlichkeit während CO-VID-19 zu einer verstärkten Konditionierbarkeit und Generalisierung von Angst führen kann. Dazu wurde eine klassische Angstkonditionierungsstudie mit gesunden ProbandInnen durchgeführt und die COVID-19 bezogene Ängstlichkeit gemessen. ProbandInnen mit höherer COVID-19 bezogener Ängstlichkeit zeigten eine Tendenz zur schlechteren Diskriminierung zwischen sicheren und gefährlichen Reizen während des Angstlernens sowie eine stärker ausgeprägte Generalisierung der Angstreaktion. Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Studie wurde in der dritten Studie untersucht, ob die Verabreichung von Glukose als kognitiver Verstärker die Effekte der Angstextinktion verbessern kann. Es wurden zwei Angstkonditionierungsstudien mit gesunden ProbandInnen durchgeführt, bei denen den ProbandInnen vor (Studie 1) bzw. nach der Extinktion (Studie 2) entweder Glukose oder ein Placebo verabreicht wurde. ProbandInnen der Glukosegruppe zeigten eine stärkere Abnahme der Angstreaktion während der Extinktion (Studie 1) und einem späteren Abruf (Studie 2), was einen ersten Beleg für die Wirksamkeit von Glukose als kognitiver Verstärker bei der Extinktion von Angst darstellt. Zusammenfassend liefern die drei in dieser Arbeit vorgestellten Studien wichtige Erkenntnisse für die aktuelle Forschung zu Prozessen der Angstextinktion und beispielsweise deren mögliche Verbesserung durch kognitive Verstärker wie Insulin oder Glukose. Zudem wird die Bedeutung von umweltbezogenen Stressfaktoren auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen durch den nachgewiesenen Einfluss des COVID-19 bezogenen Angsterlebens auf wichtige Angstlernprozesse, wie die Generalisierung von Angst, unterstrichen. Durch die Integration der gewonnenen Erkenntnisse tragen die Studien zu einem besseren Verständnis von Angstlernprozessen bei und legen dabei den Grund-stein für weitere Forschung, um mit deren Hilfe praktische Implikationen für die Verbesserung der Expositionstherapie gewinnen zu können. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-456974 hdl:20.500.11880/40240 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45697 |
| Erstgutachter: | Michael, Tanja |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 29-Apr-2025 |
| Datum des Eintrags: | 9-Jul-2025 |
| Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
| Fachrichtung: | HW - Psychologie |
| Professur: | HW - Prof. Dr. Tanja Michael |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Hauck_Publikation.pdf | Dissertation_Hauck | 3,75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.