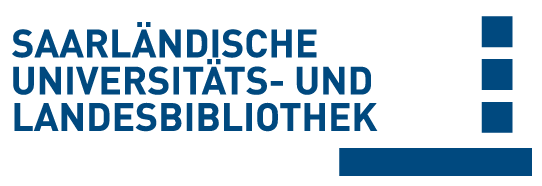Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46417 | Titel: | Undifferenzierte Oli-neu Zellen als in vitro-Modell für Multiple Sklerose : Eine Cuprizon-induzierte Reduktion der Connexin29- und PLP-1-Expression ist umkehrbar durch den Pannexin-1-Inhibitor Probenecid |
| VerfasserIn: | Kremer, Caroline |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Erscheinungsort: | Homburg/Saar |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Abstract: | Multiple Sklerose (MS) ist eine neurodegenerative Erkrankung, welche durch Symptome wie progrediente Lähmungszustände, vegetative Störungen oder kognitive und psychomotorische Veränderungen gekennzeichnet ist. Diese sind auf nervale Schädigungen im Rahmen von autoimmunbedingten Inflammationsreaktionen und Demyelinisierungen zurückzuführen. Hieran maßgeblich beteiligt sind die Oligodendrozyten, welche im differenzierten Stadium das Myelin bilden. Aber auch nicht-myelinisierende Oligodendrozyten-Vorläuferzellen werden durch die MS beeinträchtigt. Ein in vivo-Modell zur Untersuchung des Pathomechanismus der MS ist das Cuprizon-(CPZ)-Modell, anhand dessen die toxische Komponente der Erkrankung abgebildet werden kann. Durch die Applikation des Kupferchelators Cuprizon konnte ein Oligodendrozytenuntergang und folglich eine Demyelinisierung induziert werden.
Oligodendrozyten können im panglialen Synzytium mit anderen Gliazellen interagieren. Dabei erfolgt ein Informationsaustausch maßgeblich über Gap Junction-Kanäle. Diese bestehen aus Connexinen (Cx), einer Familie von Transmembranproteinen mit zelltypspezifischer Expression der Isoformen. Neben Connexinen zeichnen sich Oligodendrozyten durch die spezifische Expression weiterer Proteine, wie beispielsweise dem Proteolipid-Protein (PLP1) und dem Myelin-Basic Protein (MBP), aus. Oligodendrozyten exprimieren zudem weitere Membranproteine, die Pannexine, welche ebenfalls Membrankanäle ausbilden können. Diese Kanäle können durch den Wirkstoff Probenecid, einem Pannexin-1-Inhibitor, blockiert werden. Hierdurch konnten im Tiermodell präventive Effekte auf eine CPZ-induzierte Demyelinisierung dargestellt werden.
Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die oben genannten Proteine quantitativ und qualitativ in immortalisierten Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Zelllinie Oli-neu im undifferenzierten Zustand darzustellen. Weiterführend bestand die Überlegung, dass die Auswirkungen des CPZ auf Oligodendrozyten durch eine Dysfunktion von Connexinen oder anderen oligodendrozytenspezifischen Proteinen bedingt sein könnten, weshalb dies in vitro analysiert werden sollte. Außerdem konnte Pannexin-1 im Rahmen dieser Arbeit in Oli-neu Zellen nachgewiesen werden. Unter der Vorstellung, dass Oli-neu Zellen somit eine Zugangsmöglichkeit für PBN bieten könnten, um den CPZ-bedingten Effekten entgegenzuwirken, erfolgte die Untersuchung dieser Effekte in vitro. Hierdurch könnte eine Remyelinisierung durch Oligodendrozyten-Vorläuferzellen begünstigt werden, was so einen möglichen Ansatz zur Therapie der MS darstellen könnte.
Mittels RNA-Analyse konnten oligodendrozytäre Connexine und spezifische Proteine quantitativ und qualitativ in Oli-neu Zellen nachgewiesen werden. Auf Proteinebene erfolgte der Nachweis mittels einer Immunfluoreszenzfärbung. Da sich unter den Connexinen Cx29 als sehr stark exprimiert erwies, wurden die Oli-neu Zellen hinsichtlich dieses Connexins mit der Gefrierbruchtechnik (FRIL, Freeze-fracture replica immunogold labeling, „Gefrierbruch-Replika Immunogoldmarkierung“) im Elektronenmikroskop untersucht. Hierbei konnte eine ultrastrukturelle Ähnlichkeit zu Cx29 im peripheren Nervensystem festgestellt werden, da sich dieses Connexin sowohl in Oli-neu Zellen als auch in Schwann-Zellen des peripheren Nervensystems in hexamerer Formation, den sogenannten Rosetten, anordnete. Unter der Auffassung, dass hemihexamere Connexin-Anordnungen sich später zu ebensolchen Rosetten formieren könnten, wurden solche prägnanten Formationen als präformierende Komplexe benannt.
Durch die weiterführende CPZ-Applikation zeigte sich in Oli-neu Zellen hinsichtlich der Proteinexpression in der Immunfluoreszenzfärbung für Cx29, MBP und PLP1 ein signifikanter Abfall der immunpositiven Fläche. Durch die Applikation des PBN konnten diese Effekte für Cx29 und PLP1 umgekehrt werden.
Zusammengefasst bleibt zu unterstreichen, dass im Rahmen dieser Arbeit erstmals die ultrastrukturelle Darstellung von Cx29 in Oli-neu Zellen gezeigt werden konnte. Hieraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur weiterführenden Untersuchung der Oli-neu Zellen, z. B. hinsichtlich der Connexin-Funktion und der Connexin-Kopplung in Co-Kultivierung mit anderen Zellen. Darüber hinaus erfolgte erstmals der Nachweis von Panx1 in Oli-neu Zellen. Durch die anschließende Applikation des Pannexin-1-Inhibitoren PBN, konnten die CPZ-bedingten Effekte auf die Proteinsynthese von Cx29 und PLP1 umgekehrt werden. Somit stellt der Wirkstoff PBN einen möglichen Ansatz zur Therapie der MS dar, was es weiter zu untersuchen gilt. Immature Oli-neu cells as an in vitro model for multiple sclerosis: cuprizone-induced reduction of Connexin29- and PLP-1-expression can be reversed by the pannexin-1-inhibitor probenecid Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease characterized by symptoms like progressive paralysis, vegetative disorders or cognitive changes. These symptoms are based on axonal damage in the context of autoimmune-related inflammatory reactions and demyelination. Mature oligodendrocytes are involved in this, since they are responsible for the formation of myelin in the central nervous system. In addition, non-myelinating oligodendrocyte precursor cells are also affected by MS. There are several models for the investigation of the pathomechanism of MS. The cuprizone (CPZ) model can be used to demonstrate the toxic component of MS. The application of the copper chelator cuprizone causes oligodendrocyte death and consequently demyelination. Oligodendrocytes interact with other glial cells in the panglial syncytium by exchange of information, for example via gap junction channels. These channels consist of connexins (Cx), a family of transmembrane proteins with cell type-specific expression. In addition to this, oligodendrocytes specifically express other proteins, such as the proteolipid protein (PLP1) and the myelin basic protein (MBP). Furthermore, oligodendrocytes express another group of transmembrane proteins, the pannexins, which can form channels connecting the cytoplasm to the extracellular space. These channels can be blocked specifically by Probenecid (PBN). There are hints that PBN could reverse the effects caused by CPZ. In this work, it was the aim to visualize the mentioned proteins quantitatively and qualitatively in immortalized and immature oligodendrocyte precursor cells of the cell line Oli-neu. Moreover, it was hypothesized that the CPZ-induced effects might be caused by a dysfunction of connexins or other oligodendrocyte-specific proteins. With regard to this, the CPZ effects were analyzed in immature Oli-neu cells. In this study, pannexin-1 was detected in Oli-neu cells for the first time. Thus, the effects of CPZ and a possible counteraction by PBN should be investigated in Oli-neu cells. Via analysis of mRNA-expression, oligodendrocytic connexins and specific proteins were detected quantitatively and qualitatively in Oli-neu cells. For protein analysis, immunofluorescence staining was used. Cx29 was found to be very prominent. For examination of this connexin at the ultrastructural level, the freeze-fracture technique (FRIL, freeze-fracture replica immunogold labeling) was used. In both Oli-neu cells and Schwann-cells of the peripheral nervous system, Cx29 is frequently observed in hexameric formations, the so-called rosettes. Under the assumption that hemi-hexameric connexin arrangements could later form into these rosettes, they were called „präformierende Komplexe”. Additionally, a CPZ-application to Oli-neu cells showed a significant decrease in the immunopositive areas of Cx29, MBP and PLP1. The application of PBN reversed these effects for Cx29 and PLP1. To summarize, it remains to point out that the ultrastructural representation of Cx29 in Oli-neu cells was shown for the first time in this work. This opens many possibilities for further investigation of Oli-neu cells like the function of this connexin and potential coupling partners in co-cultivation with other cells. Furthermore, Panx1 was detected in Oli-neu cells for the first time. By the application of the Panx-1 inhibitor PBN, the CPZ-related effects on the protein synthesis of Cx29 and PLP1 could be reversed. This is why PBN represents a possible approach for the treatment of MS and should be investigated in more detail. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-464179 hdl:20.500.11880/40738 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46417 |
| Erstgutachter: | Meier, Carola |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 10-Okt-2025 |
| Datum des Eintrags: | 24-Okt-2025 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Anatomie und Zellbiologie |
| Professur: | M - Prof. Dr. Carola Meier |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_C. Kremer_10.10.2025_Onlineversion .pdf | Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin der Medizinischen Fakultät | 2,94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.